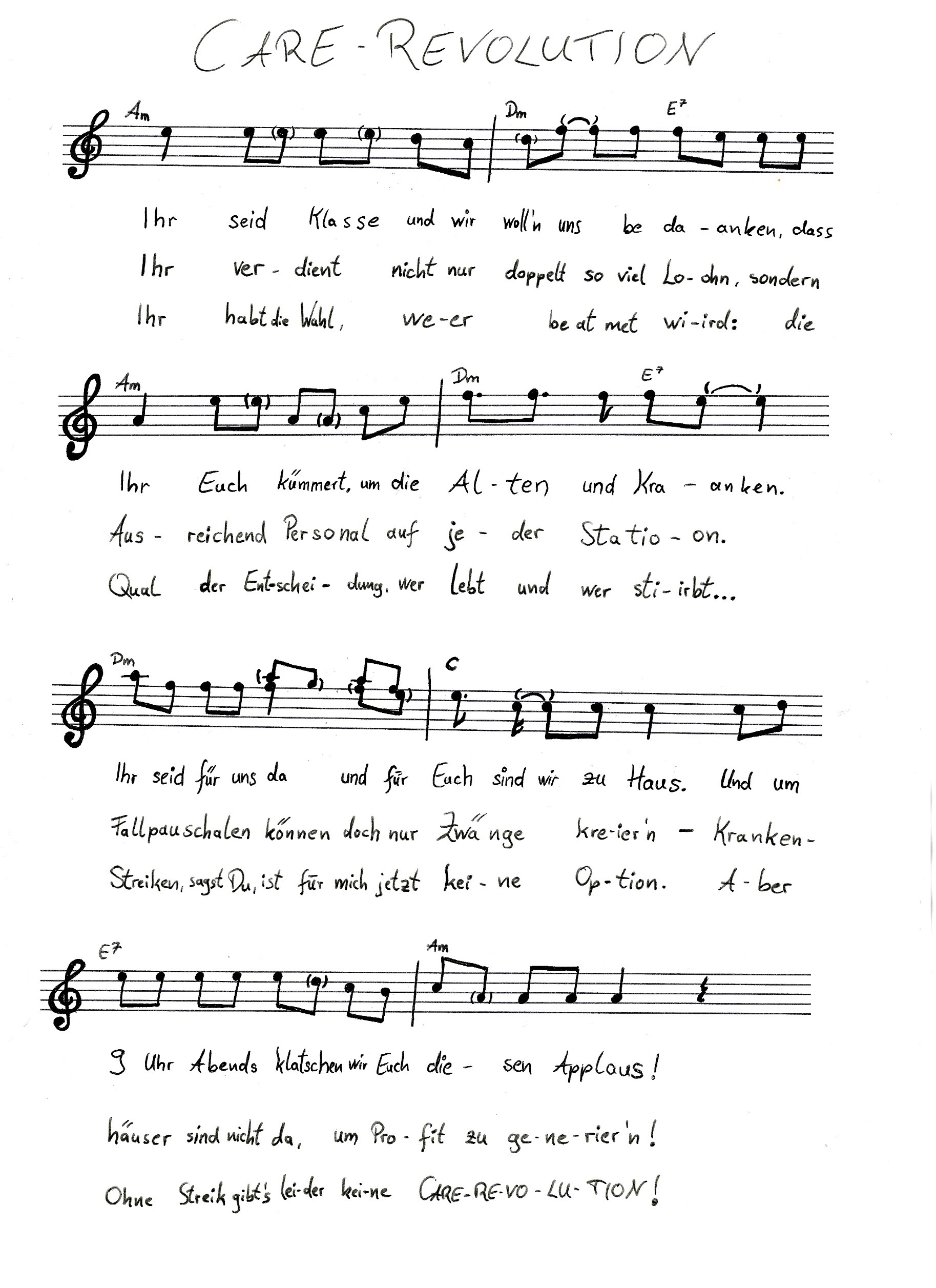Als ich vor zwei Wochen mit einer Freundin telefoniere, sagt sie mir: „Ich kann das Wort Solidarität wirklich nicht mehr hören. Als ich das gestern auf den Banner geschrieben habe, ist mir fast schlecht davon geworden.“ Irgendwie konnte ich voll gut verstehen, was sie damit meint. Dieses Wort ist so leer geworden. In einem Fenster 100 Meter von meiner Wohnung hängt ein Schild: „Noch nie konnte man sich zum Helden machen, in dem man einfach nur zuhause bleibt. Lasst euch diese Chance nicht entgehen.“ Und auch hierbei wird mir schlecht. So als könnten wir uns nur ansatzweise solidarisch zeigen, wenn wir zuhause bleiben. Solidarisch wem gegenüber und wem nicht frage ich mich.
Heute Morgen sind wir mit ca. 15 Menschen in einer Telefonkonferenz im Projekt „Cycle“. Wir haben einen Zeitrahmen geschaffen, in dem wir zum Thema „Handlungsfähigkeit“ zunächst brainstormen wollen, anschließend in die Planungsphase übergehen, um dann neun Tage konkret etwas umzusetzen. Von uns weiß keine Person, was wir denn so genau durchführen wollen, aber irgendwie fühlt es sich trotzdem total wichtig und richtig an, gerade hier zu sein. Wir sind auf der Suche nach Handlungsformen und erkennen schon hier, wie schwierig es ist, dabei offen zu bleiben und nicht direkt in Aktionismus zu verfallen und einfach die Projekte umzusetzen, die wir – alle einzeln – eh schon seit Jahren im Kopf haben. Oder eben auch nicht.
Wir hören einen Beitrag einer unserer Gefährtinnen, dass das was wir hier gerade tun, eine Form der Kollektivität, eine Form von „Kinship“, zu deutsch vielleicht „Verwandtschaft“ ist. Die Theoretikerin Haraway sagt, dass es außerhalb von Familie kaum Räume gibt, in denen wir füreinander da sind und wirkliches Miteinander erleben. Räume, denen wir uns auf lange Zeit commiten und gemeinsam wirksam sind. Füreinander einstehen. Miteinander denken. Gemeinsam handeln. Mir stößt das irgendwie auf.
Nach der Telefonkonferenz sitze ich in meiner WG. Die erst seit wenigen Wochen mein Zuhause ist. Ich erkenne Probleme und Bedürfnisse wieder, die auch schon in anderen Gruppen, in denen ich gewohnt habe „auf den Tisch kamen“. Es geht um die Aufteilung von Care-Arbeit. Irgendwie. Auf der Meta-Ebene. Und ich spüre, wie wichtig das hier gerade ist und gleichzeitig merke ich, wie innerlich in mir ein Druck steigt: In den Lagern auf den griechischen Inseln und in Gaza sterben Menschen; Im Libanon (den ich erst vor zwei Monaten verlassen habe) dürfen Menschen nicht auf die Straße gehen und ein Freund betrinkt sich regelmäßig, weil er mit seiner Isolation nicht zurechtkommt. In mir schreit es: Wir brauchen ein neues System, eine neue Gesellschaft, eine Grenzenlosigkeit, wir brauchen Solidarität. Aber wie zu Anfang gesagt, diese Begriffe wirken wie leere Hülsen, ich fühle mich nicht im Stande über diese Themen zu reden, die Welt scheint zu groß, die Mächtigen zu mächtig, ich zu klein, um irgendetwas zu verändern.
Vor zwei Jahren sitze ich mit einer Therapiegruppe nigerianischer Frauen zusammen und diskutiere das Thema meiner Bachelorarbeit: Was heißt Unterstützung und wie kann diese für Geflüchtete Frauen funktionieren. Beim Zitat „Don’t give me the fish, but teach me how to fish“ wird das Gespräch auf einmal lebendig. Ich erkenne, wie absurd es ist, helfen zu wollen, weil das Menschen entmächtigt. Menschen brauchen keine Hilfe. Sie wollen gesehen werden, sie wollen für sich selbst sprechen, sie brauchen mich nicht als Sprachrohr. Ich brauche sie viel mehr, um mir darüber klar zu werden, was überhaupt scheiße läuft. Weil ich allein nur bleierne Apathie fühle und nicht weiß, wo mir der Kopf steht. Ich schäme mich dafür.
Solidarität funktioniert nicht, wenn sich zwei Seiten bilden: Auf einer Seite, die die helfen wollen: Willkommenskultur 2015, Hilfsangebote, meine Arbeit bei der Caritas. Auf der anderen Seite, die Sprachlosen, die Armen, die Unterdrückten, die die ominöse Wahrheit gepachtet haben, an die wir leider nicht dran kommen, weil unser System blöd ist.
Das sogenannte System kann nicht kritisiert werden, wenn wir uns selber aus ihm herausziehen. Die Knoten, die es knüpft, sind in uns geknüpft. Wir fühlen die Probleme, die darin stattfinden und wir sind es auch, aus dem dieses scheiß Netz geknüpft ist. Wir können niemals raus.
Während Corona fühle ich meine Vereinzelung wie nie zuvor. Ich habe mich immer so wohl damit gefühlt, von einem Freundeskreis zum nächsten zu tingeln und mich inspirieren zu lassen und zu inspirieren. Von einer Politgruppe nehme ich Forderungen auf, die zu meinen eigenen werden, ich erschaffe nur an diesen Orten Visionen und Utopien, die mich weiter zu diesen Treffen gehen lassen. Jetzt ziehen sich viele meiner Freunde in ihre Kernfamilie, ihre Paarbeziehung oder in sich selbst zurück. Isolation, Abschottung, Überwachung erscheinen in viel zu vielen Gesprächen und Artikeln als logische Konsequenzen der „Situation“.
Jetzt bin ich wütend auf das Internet (und ich weiß, dass das komplett irrational ist). Trotzig denke ich: Wenn wir kein Internet hätten, würden die Menschen sich natürlicherweise gegen das Social Distancing erheben. Sie könnten nicht zuhause bleiben, weil ihre Existenz davon abhängen würde, weiter mit Menschen in Kontakt zu sein. Ich weiß, dass von Social Distancing Menschenleben abhängen. Im Grunde reden wir so oft bei Corona über unsere eigene Angst zu sterben oder geliebte Menschen zu verlieren. Und gleichzeitig schweigen wir irgendwie sehr laut darüber, wenn wir über Infektionsketten, die Strategie der Bundesregierung oder den Zusammenbruch des Gesundheitssystems philosophieren.
Eine Freundin, die ich im Libanon kennengelernt habe, die aus Dänemark kommt, hat mir vor sechs Wochen gesagt: „Ich habe Angst, dass wenn die Grenzen schließen, ich nicht zu der Beerdigung meiner Oma kann.“ Ihre Oma ist nicht krank, sie hat sich nicht mit Corona angesteckt und auch heute geht es ihr gut. Mir ist an dieser Stelle wichtig herauszustellen, welche tiefliegenden Ängste Menschen gerade überall bewegen: Wir sind getrennt von den Menschen, die wir lieben. Sowohl denen, die sich gerade in anderen Nationen befinden, als auch unseren Freunden, bei denen wir sonst einfach vorbeischauen könnten. Ich spüre die bleierne Vereinzelung, die ich die letzten Jahre immer schon in sogenannten kritischen Lesekreisen als Folge des Kapitalismus benannt habe, wie nie zuvor an meinem eigenen Körper. Und gerate trotzdem gleichzeitig wieder in eine Schleife der Relativierung: „Du wohnst doch mit acht anderen Menschen zusammen“; „Du bist doch immer noch in zwei Politgruppen aktiv, da macht ihr doch kollektive Arbeit.“ „Du kannst doch telefonieren.“. Aber in manchen Momenten fühlt sich das einfach nicht lebendig an. Ein riesiges Unbehagen baut sich auf und ich denke, dass ich dieses Unbehagen – was übrigens überhaupt nicht neu ist – endlich ernstnehmen muss.
Ich will endlich verstehen, was mit dieser sogenannten Solidarität gemeint sein kann und wieso ich mich so abgetrennt von ihr fühle. Und dafür muss ich mich selbst ernstnehmen. Ich muss ernstnehmen, dass die Kämpfe im Libanon gerade auch meine Kämpfe sind, weil ich mich dazu entschieden habe, dort für eine Zeit lang zu leben und weil ich mein Leben lang stark gemacht habe, dass politische Forderungen niemals an nationalen oder Sprachgrenzen Halt machen dürfen. Ich muss ernstnehmen, dass das, was ich in meiner WG und dem Cycle erfahre, Kollektive sind. Und das Haraway genau über diese spricht und nicht über irgendwelche abgefahrenen, metaphysischen Verbindungen von Quallen. Ich muss ernstnehmen, dass ich es selbst bin, die nicht mehr von diesem Gesundheitssystem versorgt werden will. Weil ich mich nicht darin gesehen fühle und weil sich meine Behandlung nur so anfühlt, als würde ich gerade eine Dienstleistung erfahren, die einen gewissen Marktwert hat. Ich will mein Bedürfnis nach wahrer Verbindung und wahrem Lernen an der Uni ernst nehmen, weil ich seit nun schon sechs Jahren dort so unglaublich unzufrieden und enttäuscht bin, weil ich glaube, dass Orte des Lernens ganz anders aussehen müssen.
Dieses Unbehagen, und das zusätzliche Ernstnehmen dieses ist erst der Anfang davon, mit Menschen ins Gespräch zu kommen: Den Kioskbesitzer zu fragen, wie es ihm eigentlich gerade in der Corona-Krise geht und wie das Geschäft läuft. Den Freund meiner Oma zu fragen, ob er nun besser mit seinem Hexenschuss klarkommt. Bei dem WG Plenum aufzutauchen und nicht zu sagen, dass ich gerade zu viel „Politkrams“ im Kopf habe. Aber darüber hinaus sich auch zu trauen, in größeren Rahmen zu denken: Die Freundin in Barcelona darin zu bestärken, den „Häuserkampf“ weiterzuführen. Die Handynummer von einer Gewerkschaftlerin an eine Freundin weiterzugeben, die gerade beim Frauen*streik eingestiegen ist. Die Aha-Momente aus dem Sprachcafé mit syrischen Frauen, das gerade natürlich nicht stattfinden kann, aber irgendwie weiter über Beziehungen untereinander läuft, mit Menschen zu teilen. Sei es in Form eines Artikels oder halt bei einem Glas Wein.
Wir brauchen Formen der kollektiven Handlungsfähigkeit. Wir brauchen Räume, in denen wir kreativ sein können und keine Angst haben müssen, das zu benennen, was gerade in uns lebendig ist. Wir müssen offen für Wandel sein, weil Wandel aufregend ist und Lernen essentiell ist, um uns lebendig zu fühlen. Ich brauche Menschen, die Lust haben, mit mir aktiv zu sein. Sei es in meinem Wohn-, Arbeits-, oder Politkontext oder in meiner romantischen Beziehung. Ich glaube nicht, dass das Wort Solidarität abgenutzt ist. Ich glaube, wir brauchen es mehr denn je.